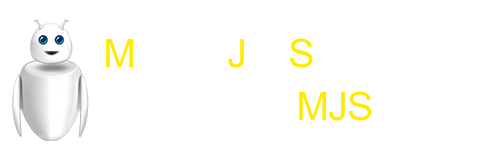1. Sinn und Zweck der Probezeit
Statistiken zufolge endet jedes fünfte Arbeitsverhältnis in Deutschland während der Probezeit. Besonders für Arbeitnehmer kann diese Zeit schwierig werden. Die einen sehen das Thema „Probezeit“ völlig entspannt, während andere diese tagtäglich als Damoklesschwert über sich schweben sehen und schon mit einem unguten Gefühl zur Arbeit gehen. Ein Beispiel: Die Firma XY hat sich für Mark S. als neuen Mitarbeiter entschieden und schließt mit ihm einen befristeten Arbeitsvertrag. Der Lebenslauf war einigermaßen akzeptabel gewesen, seine vorgelegten Zeugnisse mittelmäßig, aber der junge Mann hatte letztendlich durch sein kompetentes und sympathisches Auftreten überzeugt. Auch ein Probearbeiten war zur Zufriedenheit aller ausgefallen. Trotz einiger Bedenken wollte der Personalchef ihm in seiner Firma eine Chance geben. Mark S. sollte sich beweisen und dieser gab sein Bestes. Nicht immer ist das Beste gut genug, in diesem Fall aber schon. Der neue Mitarbeiter erwies sich als zuverlässig, er war interessiert an den betrieblichen Zusammenhängen. Schnell bekam er guten Kontakt zu Vorgesetzten und Kollegen und seine Arbeitsleistung ließ nichts zu wünschen übrig. Mark S. bestand die Probezeit erfolgreich und befindet sich jetzt in einem zunächst befristeten Arbeitsverhältnis mit der Option, dass dieses unbefristet werden kann. Natürlich hätte es auch anders kommen können und die Zusammenarbeit wäre schnell beendet gewesen. So etwas kann passieren, wenn die eigenen positiven Vorstellungen von der Wirklichkeit unangenehm eingeholt werden. So wie in diesem Fall:FAZIT: Die Probezeit ist dafür gedacht, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber herausfinden können, ob man künftig erfolgreich zusammenarbeiten kann und sich wohlfühlt. Probezeit = Erprobung für Arbeitnehmer und Arbeitgeber.
2. Dauer der Probezeit
Die Probezeit für ein Arbeitsverhältnis wird im Arbeitsvertrag festgelegt, die Dauer kann unterschiedlich sein. Es gibt je nach Vertragsart unterschiedliche Möglichkeiten. Den unbefristeten Arbeitsvertrag, den befristeten Arbeitsvertrag, das befristete Probearbeitsverhältnis und das Ausbildungsverhältnis.
Was ist was und wie verhält es sich mit der Probezeit?
Die Probezeit wird in der Regel 6 Monate nicht überschreiten, eine gesetzliche Obergrenze gibt es aber nicht. Gemäß § 622 Abs. 3 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) ist die verkürzte Kündigungsfrist von 2 Wochen für die Probezeit für ein Arbeitsverhältnis höchstens 6 Monate anwendbar. Eine Probezeit ist nicht zwingend vorgeschrieben. Arbeitnehmer und Arbeitgeber können innerhalb der Probezeit einvernehmlich vereinbaren, dass eine ursprünglich kürzere Probezeit auf bis zu sechs Monate verlängert wird.
Die Vorschriften zu Kündigungsfristen findet man im BGB – hier ein Auszug:
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
§ 622 Kündigungsfristen bei Arbeitsverhältnissen
- Während einer vereinbarten Probezeit, längstens für die Dauer von sechs Monaten, kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden.
- Von den Absätzen 1 bis 3 abweichende Regelungen können durch Tarifvertrag vereinbart werden. Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrags gelten die abweichenden tarifvertraglichen Bestimmungen zwischen nicht tarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, wenn ihre Anwendung zwischen ihnen vereinbart ist.
Bei einem unbefristeten Arbeitsvertrag („unbefristeter Arbeitsvertrages mit vorgeschalteter Probezeit“) muss eine Kündigung innerhalb der Probezeit erfolgen, wenn das Arbeitsverhältnis nach Ablauf der Probezeit nicht fortgesetzt werden soll. Wird nicht gekündigt, gilt der Arbeitsvertrag für einen unbestimmten Zeitraum.
Auch für einen befristeten Arbeitsvertrag kann eine Probezeit vereinbart werden. Wird die Probezeit erfolgreich absolviert, endet der Arbeitsvertrag dann wie im Vertrag vereinbart. (Beispiel: Der befristete Arbeitsvertrag beginnt am 01.01.2025 und endet zum 31.12.2025 und die vereinbarte Probezeit beträgt 3 Monate. Wird nicht von einer der beiden Seiten innerhalb der Probezeit gekündigt, läuft der Vertrag automatisch bis zum 31.12.2025 und endet dann ohne dass eine Kündigung erfolgen muss.)
Bei einem Ausbildungsverhältnis MUSS eine Probezeit vereinbart werden. Sie beträgt zwischen ein und vier Monaten.
Es gibt auch ein befristetes Probearbeitsverhältnis – solch ein Arbeitsverhältnis wird zu dem Zweck geschlossen, dass eine Erprobung erfolgen kann, die Dauer muss angemessen sein. (Vertrag mit Sachgrund). Dieser Vertrag bedarf der Schriftform – er endet automatisch, wenn das Probearbeitsverhältnis endet.
Ist im Arbeitsvertrag keine Probezeit vereinbart, bedeutet das, dass zwar nicht mit der verkürzten Kündigungsfrist von 14 Tagen gekündigt werden kann, das Kündigungsschutzgesetz ist jedoch erst nach Ablauf von sechs Monaten ununterbrochener Betriebszugehörigkeit anwendbar. Auch eine Kündigung ohne Angabe von Gründen ist nicht möglich.
Achtung: Tarifverträge können andere Fristen enthalten, diese müssen dann Anwendung finden.
FAZIT:
In der Regel ist die Probezeit im Arbeitsvertrag auf bis zu 6 Monate befristet.
Innerhalb der Probezeit gilt im Allgemeinen eine verkürzte Kündigungsfrist von 2 Wochen.
Eine Probezeit ist nicht zwingend vorgeschrieben.
3. Urlaub in der Probezeit
Stellen Sie sich bitte folgendes Szenario vor:
Sie glauben, dass Sie einen sicheren Arbeitsplatz haben und buchen für das Folgejahr einen kostenintensiven Urlaub.
Anfang des neuen Jahres bekommen Sie die Schreckensmeldung, dass Ihr Arbeitgeber insolvent ist und Sie müssen sich einen neuen Job suchen.
Die Jobsuche ist erfolgreich, Sie können zum 1. April Ihren neuen Arbeitsplatz bekommen. Natürlich enthält der Arbeitsvertrag eine Probezeit – in diesem Fall sechs Monate. Das bedeutet, dass Ihr geplanter Urlaub in die Probezeit fallen würde…
Den vollen Anspruch auf den zustehenden Jahresurlaub hat man gemäß § 4 BUrlG (Bundesurlaubsgesetz) erst nach Ablauf der Probezeit. Nach § 5 BUrlG erwirbt man situationsbedingt für jeden Monat eines bestehenden Arbeitsverhältnisses einen Anspruch auf Teilurlaub.
Mindesurlaubsgesetz für Arbeitnehmer (Bundesurlaubsgesetz)
§ 5 Teilurlaub
- Anspruch auf ein Zwölftel des Jahresurlaubs für jeden vollen Monat des Bestehens des Arbeitsverhältnisses hat der Arbeitnehmer
- für Zeiten eines Kalenderjahrs, für die er wegen Nichterfüllung der Wartezeit in diesem Kalenderjahr keinen vollen Urlaubsanspruch erwirbt
- wenn er vor erfüllter Wartezeit aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet
- wenn er nach erfüllter Wartezeit in der ersten Hälfte eines Kalenderjahrs aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet
- Bruchteile von Urlaubstagen, die mindestens einen halben Tag ergeben, sind auf volle Urlaubstage aufzurunden
- Hat der Arbeitnehmer im Fall des Absatzes 1 Buchstabe c bereits Urlaub über den ihm zustehenden Umfang hinaus erhalten, so kann das dafür gezahlte Urlaubsentgelt nicht zurückgefordert werden.
Eine andere gesetzliche Regelung im Bundesurlaubsgesetz besagt:
§ 4 Wartezeit
Der volle Urlaubsanspruch wird erstmalig nach sechsmonatigem Bestehen des Arbeitsverhältnisses erworben.
Zusammengefasst bedeutet das, dass man in der Probezeit seinen Urlaubsanspruch quasi ansparen muss. Unvorhergesehene Ereignisse, wie zum Beispiel ein Todesfall in der Familie, rechtfertigen natürlich einige wenige freie Tage. Die Grundlage dazu findet man hier:
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
§ 616 Vorübergehende Verhinderung
Der zur Dienstleistung Verpflichtete wird des Anspruchs auf die Vergütung nicht dadurch verlustig, dass er für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden an der Dienstleistung verhindert wird. Er muss sich jedoch den Betrag anrechnen lassen, welcher ihm für die Zeit der Verhinderung aus einer auf Grund gesetzlicher Verpflichtung bestehenden Kranken- oder Unfallversicherung zukommt.
Grundsätzlich ist es natürlich nicht „verboten“ während der Probezeit Urlaub zu beantragen, aber ob es taktisch sinnvoll ist, das muss man selbst herausfinden. Fakt ist, dass ein Arbeitgeber nicht verpflichtet ist, während der Probezeit einen längeren Urlaub zu gewähren.
Für unser Beispiel bedeutet das, dass man solche eine Urlaubsplanung vor einem eventuellen Vertragsabschluss ansprechen und abstimmen muss. Im Zweifelsfall steht man vor der Entscheidung „Neuer Job“ oder „Finanzieller Verlust durch Nichantritt des Urlaubs“.
FAZIT:
Urlaub in der Probezeit ist nicht grundsätzlich auszuschließen, sollte aber nur in wirklich dringenden Fällen beantragt werden.
Der Urlaubsanspruch in der Probezeit wird monatlich unter Berücksichtigung der Wartezeiten gesammelt.
4. Krankheit in der Probezeit
Was passiert, wenn man in der Probezeit krank wird? Fall 1:
Melanie R. erkrankt nach zwei Monaten Probezeit schwer,
sie teilt das dem Arbeitgeber unverzüglich mit und reicht ihre Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ein.
Fall 2:
Am Morgen des zweiten Arbeitstages in der Probezeit hat Sarah R. eine leichte Erkältung und wird von ihrem Arzt deshalb für drei Tage krankgeschrieben.
Wird das nun Konsequenzen haben und vielleicht sogar die Kündigung nach sich ziehen?
Das kommt auf den Arbeitgeber, die Einzelumstände und die betrieblichen Belange an.
Während der Probezeit besteht keine Pflicht, eine Kündigung zu begründen.
Fakt ist, dass man natürlich bei schweren und ansteckenden Krankheiten der Arbeit fernbleiben wird und muss. Ob man sich wegen eines kleinen Schnupfens nicht in der Lage fühlt, zu arbeiten, das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Wichtig ist es, seinen Pflichten nachzukommen. Das bedeutet, dass man umgehend den Arbeitgeber informiert, wenn man nicht zur Arbeit kommen kann.
Des Weiteren sollte man einen Blick in den Arbeitsvertrag werfen und herausfinden, ab wann eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen ist. Meist wird das zwar erst ab dem vierten Tag der Krankheit sein, es kann aber auch der erste Tag des Fernbleibens vertraglich vereinbart werden. Eine weitere Pflicht des Arbeitnehmers ist es, dafür zu sorgen, dass er so schnell wie möglich gesund wird.
Wie ist das mit der Bezahlung? Wenn Sie bereits länger als vier Wochen (28 Tage) bei dem neuen Arbeitgeber ununterbrochen beschäftigt sind, tritt bei längerer Krankheit die Lohnfortzahlung nach sechs Wochen Krankheitsdauer ein. Bis zu diesem Zeitpunkt zahlt unter Umständen der Arbeitgeber. War man weniger als vier Wochen beschäftigt, erhält man in diesem Fall Geld von der Krankenkasse.
Wichtig ist außerdem, dass die Arbeitsunfähigkeit nicht selbst verschuldet worden ist.
Die Dauer der Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit liegt im Ermessen des behandelnden Arztes, sie stellt allerdings keine Verpflichtung dar, der Arbeit fernzubleiben, wenn man vor Ablauf der Bescheinigung wieder gesund ist.
Erhält man während der Krankheit die Kündigung, ist aber über das Ende der Kündigungsfrist hinaus krank, wird man in der Regel Krankengeld von der Krankenkasse bekommen. Ist die Krankheit der Anlass der Kündigung, tritt das Entgeltfortzahlungsgesetz in Kraft. Die Kündigung darf allerdings nicht sittenwidrig sein.
Also muss man einfach nur im Betrieb anrufen und Bescheid sagen, dass man krank ist und ggf. eine Krankschreibung einreichen? Vom Gesetz her genügt das sicherlich, allerdings kann auch in diesem Fall ein Gespräch hilfreich sein. Reden Sie mit Ihrem Arbeitgeber, teilen mit, wann Sie…
Das Entgeltfortzahlungsgesetz im Auszug:
Gesetz über die Zahlung des Arbeitsentgelts an Feiertagen und im Krankheitsfall (Entgeltfortzahlungsgesetz)
§ 3 Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
(1) Wird ein Arbeitnehmer durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an seiner Arbeitsleistung verhindert, ohne dass ihn ein Verschulden trifft, so hat er Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall durch den Arbeitgeber für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis zur Dauer von sechs Wochen. Wird der Arbeitnehmer infolge derselben Krankheit erneut arbeitsunfähig, so verliert er wegen der erneuten Arbeitsunfähigkeit den Anspruch nach Satz 1 für einen weiteren Zeitraum von höchstens sechs Wochen nicht, wenn
- er vor der erneuten Arbeitsunfähigkeit mindestens sechs Monate nicht infolge derselben Krankheit arbeitsunfähig war oder
- seit Beginn der ersten Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit eine Frist von zwölf Monaten abgelaufen ist.
(2) Als unverschuldete Arbeitsunfähigkeit im Sinne des Absatzes 1 gilt auch eine Arbeitsverhinderung, infolge einer nicht rechtswidrigen Sterilisation oder eines nicht rechtswidrigen Abbruchs der Schwangerschaft eintritt. Dasselbe gilt für einen Abbruch der Schwangerschaft, wenn die Schwangerschaft innerhalb von zwölf Wochen nach dem Empfängnis durch einen Arzt abgebrochen wird, die schwangere Frau den Abbruch verlangt und dem Arzt durch eine Bescheinigung nachgewiesen hat, dass sie sich mindestens drei Tage vor dem Eingriff von einer anerkannten Beratungsstelle hat beraten lassen.
(3) Der Anspruch nach Absatz 1 entsteht nach vierwöchiger ununterbrochener Dauer des Arbeitsverhältnisses.
FAZIT:
Wer krank und arbeitsunfähig ist, geht natürlich nicht zur Arbeit. Die Fristen zur Krankmeldung müssen gewahrt werden.
Es gibt keinen Kündigungsschutz während der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in der Probezeit.
Die Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber hängt von verschiedenen Umständen ab.
5. Kündigung in der Probezeit
Für die Probezeit gelten bei einem Arbeitsverhältnis besondere Kündigungsfristen.
Innerhalb der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist zwei Wochen, meist mit der Frist zum Monatsende oder zum 15ten des Monats.
Auch am letzten Tag der Probezeit kann noch gekündigt werden.
Ausschlaggebend für die Fristwahrung ist der Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung.
Ein Grund muss innerhalb der Probezeit nicht genannt werden.
Besondere Ausnahmen bieten jedoch einen gewissen Kündigungsschutz – hiervon betroffen sind zum Beispiel Kündigungen aus diskriminierenden Gründen.
Aus einem wichtigen Grund kann außerordentlich gemäß § 626 BGB gekündigt werden. (Fristlose Entlassung). In diesem Fall muss die Kündigung begründet werden.
Eignet sich der Arbeitnehmer zum Beispiel nicht für die Tätigkeit, für die er eingestellt wurde, ist das kein Grund zur fristlosen Kündigung. Wenn ein Arbeitnehmer zum Beispiel Firmeneigentum stiehlt, kann er fristlos entlassen werden. In diesem Fall ist das Arbeitsverhältnis sofort beendet.
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
§ 626 Fristlose Kündigung aus wichtigem Grund
- Das Dienstverhältnis kann von jedem Vertragsteil aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, auf Grund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Dienstverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zur vereinbarten Beendigung des Dienstverhältnisses nicht zugemutet werden kann.
- Die Kündigung kann nur innerhalb von zwei Wochen erfolgen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Kündigungsberechtigte von den für die Kündigung maßgebenden Tatsachen Kenntnis erlangt. Der Kündigende muss dem anderen Teil auf Verlangen den Kündigungsgrund unverzüglich schriftlich mitteilen.